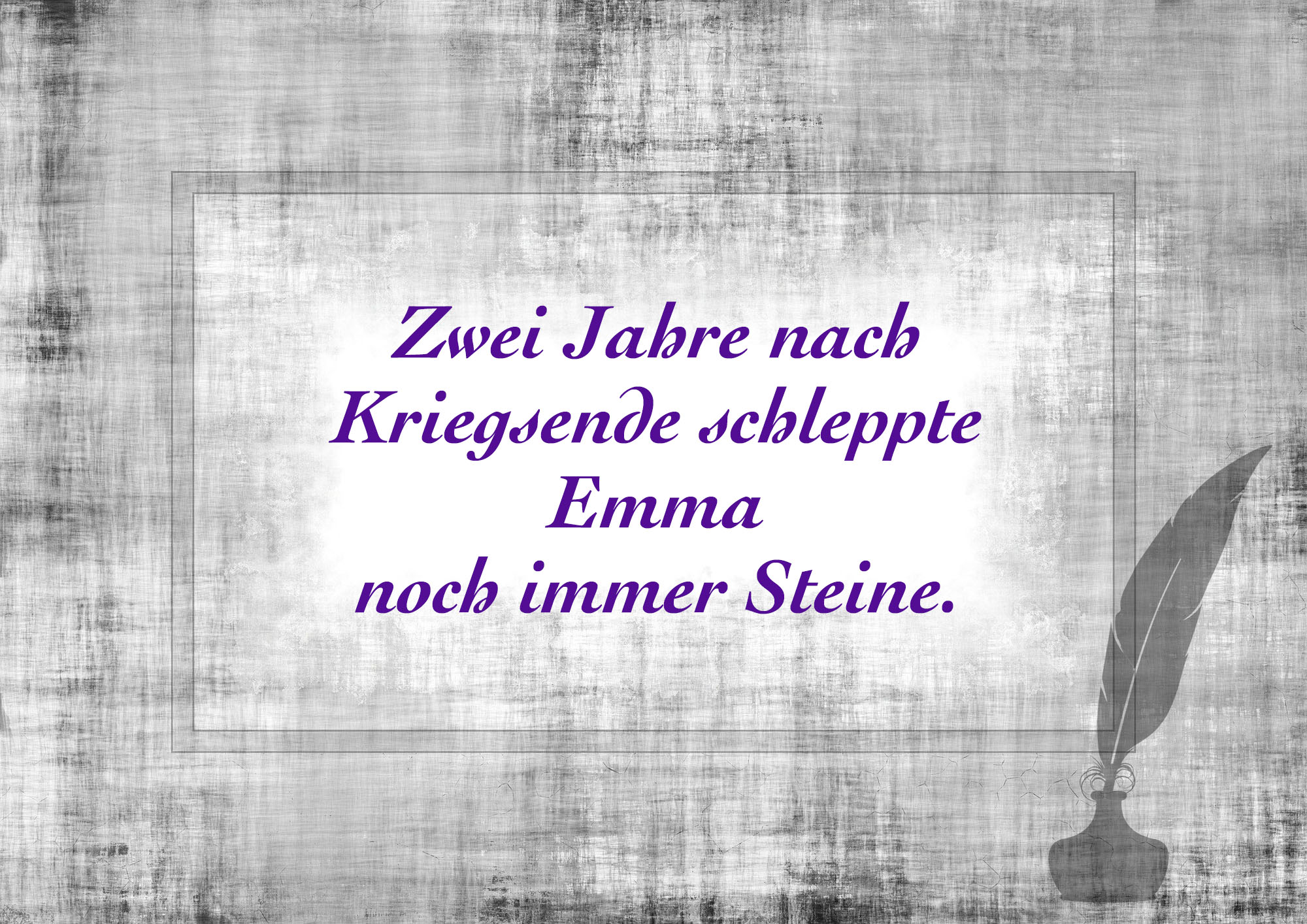Fritz und Emma
Inhalt
1947: Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz doch noch aus dem Krieg in ihr Heimatdorf zurückgekehrt ist. Schon lange sind sie ein Paar, nun fiebert Emma der Heirat entgegen. Doch der Krieg hat einen Schatten auf Fritz‘ Seele gelegt, gegen den nicht einmal Emma mit all ihrer Liebe ankommt. Und dann, in der Nacht, die eigentlich die glücklichste ihres Lebens sein sollte, geschieht etwas Schreckliches, das alles verändert.
2019: Marie ist mit ihrem Mann neu nach Oberkirchbach gezogen und lernt nach und nach die Einwohner des Dörfchens kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz Draudt und die ebenso alte Emma Jung, die am entgegengesetzten Ende des Dorfes lebt. Marie erfährt, dass die beiden seit fast siebzig Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Dabei wollten sie einst heiraten. Marie nimmt sich vor, Fritz und Emma wieder miteinander zu versöhnen, bevor es zu spät ist …
Was ich noch dazu sagen möchte
Mit Fritz und Emma habe ich zum ersten Mal einen Roman geschrieben, der auf dem Dorf spielt. Oberkirchbach heißt dieses Dorf, und es ist, ebenso wie all seine Bewohner, erfunden. Oberkirchbach gibt es nicht.
Aber es gibt Mühlbach. Da komme ich her. Ein kleines Dorf in der Pfalz und zugegebenermaßen das Vorbild für Oberkirchbach. Viele Schauplätze sind meinem Heimatort nachempfunden.
Wie in Oberkirchbach liegt die evangelische Kirche auf einer Anhöhe und eine lange Treppe führt da hinauf. Oder man muss den weiten Weg „hinten rum“ gehen, am Friedhof vorbei. Wie in Oberkirchbach zieht sich der Ortskern unten an der Hauptstraße entlang und oben am Hang wird gebaut. Was in Oberkirchbach der Kirchbach ist, ist in Mühlbach der Glan. An seinem Ufer erstreckt sich das Dorf zwischen dem ehemaligen Steinbruch auf der einen Seite und den bewaldeten Hügeln des Potzberg auf der anderen.
Ich bin vor vielen Jahren dort weggezogen, zum Studieren nach München, und hier bin ich geblieben. Aber ich beherrsche noch immer den wunderschönen Dialekt (nein, keine Widerrede, er ist wunderschön), ich mag die Menschen dort, und ich finde die Gegend traumhaft. Und mir blutet das Herz, wenn ich mitbekomme, wie dort immer mehr verloren geht.
Ein kleines Beispiel: Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich der Gesangverein aufgelöst. Ja, richtig, ein spießiger Dorfgesangverein, wo die Männer bei Auftritten Anzug und Krawatte tragen und die Frauen etwas Hübsches. Und irgendwie klingt es immer ein bisschen naja und meistens ist das Repertoire auch schon reichlich angestaubt und sollte einmal überdacht werden. Aber als ich davon hörte, dass es den Gesangverein nun nicht mehr gibt, war ich selbst überrascht, wie tief betroffen mich das machte. Wie entsetzt ich war. Man löst keinen Dorfgesangverein auf. Das tut man einfach nicht. Das ist so, als würde man sämtliche Wiederbelebungsmaßnahmen beenden.
Mein Großvater war im Vorstand des Gesangvereins und sehr stolz darauf, meine Eltern haben beide in jungen Jahren dort mitgesungen, meine Mutter war der Star und hat Soli gesungen, so dass man in den Dörfern außerhalb immer dachte: Oh, die Mühlbacher, die haben eine ausgebildete Sängerin. Dabei hatte meine Mutter zwar das Talent, aber nie die Chance, ihre Stimme ausbilden zu lassen. (Das Talent hat sie meiner Schwester vererbt und die Ausbildung wurde ihr ebenfalls ermöglicht.)
Der Gesangverein! Er hat bei hohen runden Geburtstagen und Goldenen Hochzeiten gesungen, draußen unterm Fenster, bei Beerdigungen, wenn der Verstorbene das wollte, was er tunlichst noch zu Lebzeiten kundtun musste, und vor allem an Weihnachten in der Kirche. Immer dieselben Lieder, immer hat man eine Sopranstimme herausgehört. Weihnachten ohne „Heilige Nacht“ voll Inbrunst und mit viel Würde vom Chor gesungen, wäre kein Weihnachten gewesen.
Und jetzt gibt es keinen Gesangverein mehr, weder einen spießigen, überalterten, noch einen fortschrittlicheren mit jüngeren Stimmen und zeitgemäßem Ansatz. Gar keinen. Er gehört zu den Dingen, die einfach so verschwinden. Der Bäcker verschwindet, die Post, der Metzger, die Kneipe, der Bus fährt dreimal am Tag, ok, vielleicht viermal. Kein Pfarrer, kein Arzt. Ohne Auto geht nichts.
Und kein Hahn kräht danach.
Und warum kratzt mich das in meinem München, wo ich alles in Hülle und Fülle habe und gleich um die Ecke? Ich bin doch auch weggegangen.
Vielleicht deshalb. Vielleicht habe ich den verrückten Wunsch, auf meine Weise die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo sie sonst niemals ist. Dorthin, wo es eigentlich so schön ist.
Mir war schon lange klar, dass ich irgendwann einmal einen Roman schreiben würde, der dort in der Pfalz, genauer gesagt in der Hinterpfalz, spielt, im Westrich.
Als Fritz und Emma mit ihrer großen Liebesgeschichte in meinem Kopf lebendig wurden, wusste ich, dass es nur einen Ort auf der Welt geben kann, an dem sich diese Geschichte zuträgt und so entstand Oberkirchbach, wo die Uhren anders schlagen und alles ein bisschen mühsamer ist. Oberkirchbach mit seinen liebenswerten Bewohnern, mit zwei sturen alten Menschen, deren Geschichte einem das Herz zerreißt, und mit Marie, die die Oberkirchbacher an der Hand nimmt und die wunderbare Gabe besitzt, Herzen wieder zusammenzusetzen.
Oberkirchbach ist eine Hommage an alle kleinen Dörfer, die irgendwo unauffällig und unbeachtet zwischen Hügeln liegen, und es ist zugleich eine Liebeserklärung an den Ort meiner Kindheit.
1947
Zwei Jahre nach Kriegsende schleppte Emma noch immer Steine. Zwei Jahre nachdem die letzte Bombe gefallen war, nachdem die fremden Soldaten durchs Dorf gezogen waren mit Gewehren im Anschlag, ab und zu etwas gerufen hatten, in einer fremden Sprache, amerikanisch, wie Frieda gesagt hatte. »Das sind Amerikaner«, hatte sie geflüstert, als ob man sie auch dort unten im Keller hören könnte. Da hatten sie gesessen, geduckt und verängstigt, hatten darauf gewartet, dass die fremden Soldaten eindringen und sie alle erschießen würden, so wie sie es verdient hatten. Fritz hatte das früher immer gesagt: »Eines Tages wird uns die Welt bestrafen für das, was wir ihr antun.«
»Um Himmels willen, Fritz, sei still. Sag das nicht laut«, hatte Emma geantwortet. Voller Angst um ihn. Sie würden auch vor einem Jungen nicht Halt machen, der laut sagte, was er dachte. Und Fritz dachte so einiges über die Nazis, über Hitler, über den Wahnsinn, den man Krieg nannte. Nur ihr flüsterte er es zu, wenn er glaubte, sein Herz würde vor ohnmächtiger Wut explodieren, ihr konnte er vertrauen. Und dann, kurz vor Schluss, holte auch ihn der Krieg. Er war achtzehn geworden. Er musste gehen. Fürs Vaterland kämpfen, obwohl er nicht wollte, obwohl es da nichts mehr zu kämpfen gab, obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr nach Hause kommen würde. Sie hatten einander nur kurz umarmt, nur flüchtig geküsst, aus Angst, alles, was darüber hinausging, würde es ihnen unmöglich machen, sich zu trennen. Aber sie hatten einander versprochen zu überleben, sich wiederzusehen und gemeinsam alt zu werden. Dann war er gegangen und hatte sich nicht mehr umgedreht. Seither hatte sie nichts mehr von ihm gehört.
Ein paar Wochen später war das Haus seiner Eltern getroffen worden und beide waren ums Leben gekommen, ebenso sein jüngerer Bruder und seine Großeltern. Es waren die Steine dieser Ruine, die Emma schleppte. Und sie dachte dabei an Fritz. Jeder Stein, den sie forttrug, so dachte sie, brachte ihn ein Stück näher zu ihr.
Er war vermisst, nicht gefallen, zumindest war es nicht bekannt, aber alle im Dorf glaubten es. Am Anfang hatten sie ihr noch geholfen. Als klar war, dass die Amerikaner sie nicht alle erschießen würden, als sie sich wieder in ihre Häuser zurücktrauten und anfingen aufzuräumen, da hatten sich einige auch um das Haus der Familie Draudt gekümmert. Aber jeder hatte ja seine eigenen Sorgen, und dann kamen die Franzosen als Besatzer und mit ihnen noch mehr Sorgen, und die Toten waren ja tot. Am Schluss war es nur noch Emma, die jeden Abend nach der Arbeit kam und ein paar Steine wegräumte. Zwei Jahre lang.
Sie hatte schon viel geschafft. Es sah nicht mehr aus wie ein zerbombtes Haus, es sah aus wie ein Loch in der Welt, ein großes Nichts mit ein paar Trümmern. Manchmal stand sie einfach nur eine Weile davor, dachte an Fritz und daran, wie sehr sie sich wünschte, ihn noch einmal zu sehen, ihn noch einmal zu hören, doch noch mit ihm alt zu werden. Schließlich packte sie ein paar Steine in den Korb, um sie wegzubringen, meist zur Böschung am Bach. Das half sogar, wenn er bei Hochwasser wieder einmal über die Ufer trat. Oder oben zum Waldrand, in der Nähe ihres eigenen Elternhauses.
An einem Abend im April 1947 stand sie wieder mit ihrem Korb vor diesem Trümmerfeld, auf dem einmal ein Haus gestanden hatte, in dem einmal Leben geherrscht hatte und Freude. Sie schloss die Augen und dachte an Fritz.
»Emma!«, hörte sie eine Stimme hinter ihrem Rücken, die entfernt wie seine klang. »Ich bin wieder da.«
Sie schlug die Augen auf, drehte sich aber nicht um. Es war doch nur ihre lebhafte Fantasie, die zu ihr sprach, ihr tiefster Wunsch, ihre Sehnsucht, was auch immer.
»Ich bin wieder da, Emma«, wiederholte die Stimme und kam näher.
»Ich bin da.«
LESEPROBE